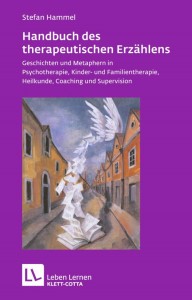Gestern fragte mich jemand nach einer Geschichte für eine Borderline-Patientin, die sich ritzt und sich oftmals schämt, weil die Haut ihrer Arme so rau und vernarbt ist. Ich sagte zu ihr:
„Vielleicht ist es dir auch schon passiert, dass du auf der Autobahn auf die Randlinie gefahren bist. Früher hat man zum Zeichnen dieser Randlinien einfach Farbe verwendet. Man hatte aber das Problem, dass manchmal Leute auf der Strecke eingeschlafen sind und von der Spur abgekommen sind. Dann hatte jemand eine gute Idee. ‚Wenn die Randlinie aus einem Material mit Querrillen ist, dann gibt es ein lautes Geräusch, sobald jemand mit seinem Auto die Rille berührt. Man wacht sofort auf und kommt zurück auf die richtige Spur.‘ Sie haben das ausprobiert, und schon nach den ersten Versuchen hat es immer besser geklappt: jedesmal, wenn jemand diese Grenzlinie schnitt oder sie überhaupt auch nur am Rande mit seinem Reifen berührte, gab es ein so lautes Signal, dass die Leute sofort zurücklenkten und weiterfuhren auf der dafür vorgesehenen Spur. Seit sie dieses Warnsignal beim Berühren derRandlinie eingeführt haben, sind Unfälle dieser Art weit zurückgegangen. Man kennt die Methode inzwischen auch bei Mittellinien und anderen in Frage kommenden Markierungen.“